Corona – es reicht! Nur diese eine Frage noch…
Es ist vorbei! Womit? Corona? Sicher nicht. Aber in Gedanken sind wir schon lange woanders: ab in die weite Welt! Wer will jetzt noch wissen, was das alles zu bedeuten hatte – Sorgen von Stubenhockern. Doch halt! Die Antwort auf die letzte dumme Frage steht noch aus, nur diese eine noch, versprochen!
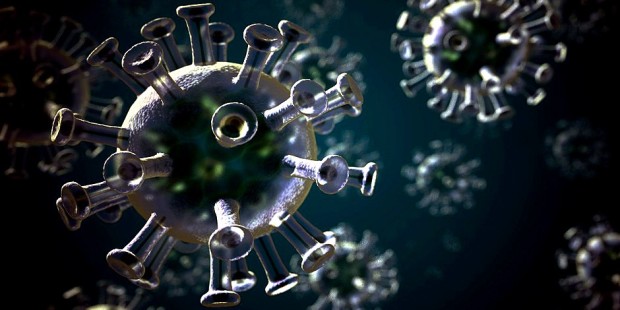 Welche Farbe hat das Virus? Ein Mond ist aufgegangen, siehst du seinen Silberglanz? Ach, wie romantisch... Foto: HFCM Communicatie / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 4.0int
Welche Farbe hat das Virus? Ein Mond ist aufgegangen, siehst du seinen Silberglanz? Ach, wie romantisch... Foto: HFCM Communicatie / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 4.0int
(Michael Magercord) – Schön wär’s gewesen: Wenn der großen Politik, weil sie nun einmal funktioniert wie sie funktioniert, nichts Besseres einfallen kann, als die alte Normalität wieder herzustellen, dann müssen eben wir, die Kleinstaatler dieser Welt, es richten. Her mit unseren neuen Ideen für eine gelingende Zukunft, und schon wird alles anders – und besser natürlich sowieso!
So lautet jedenfalls die bereits im ersten Teil dieser Betrachtung als wenig realistisch erkannte Hoffnung auf Erlösung – und zwar aus jenem Zustand, in dem die Worte „zukunftssicher“ und „zukunftsfest“ in sich widersprüchliche Begriffe bleiben. Daraus wird aber erst einmal nichts, denn die Zukunft, jenes Jenseits der Moderne, ist der Moderne abhanden gekommen. Und im zweiten Teil wurde zumindest einmal versucht sich klarzumachen, woran es eigentlich liegt, dass wir ach so modernen Menschen es auch dieses Mal wieder nicht schaffen, den Ausgang hinaus aus den festen Gebäuden unserer Gedanken zu finden, um hinein in die offenen Landschaften unserer Seelen zu gelangen. Dabei ist die Ursache der Orientierungslosigkeit – wie immer – ein ganz einfache: Sie liegt in den falschen Fragen.
Heiteres Beruferaten – Was ist der Mensch? Was bin ich? Und wer? Ob Immanuel Kant, Robert Lemke oder Gender*innen – alle ihre Fragen führen uns nur weiter in die Irre. Und in der Irre stecken wir schon ziemlich tief drin. Woran merkt man das? Daran, dass wir den Zugang zur Einfachheit unserer Probleme bisher nicht gefunden haben. Darauf hatte uns Jean-Luc Nancy ja an dieser Stelle schon das ein oder andere Mal hingewiesen. Wären die Lösungen unserer Probleme zu einfach, um als wahr gelten zu können? Die Wirklichkeit derart versimpeln will der Straßburger Philosoph sicher nicht, aber er hat uns damit die Erkenntnis mit auf den Weg gegeben, dass mit den alten Fragen und den hinter ihnen stehenden Begriffen von Identität, Freiheit und Gerechtigkeit dem modernen Irrsinn nicht beizukommen ist – und es stimmt ja, im Grunde ist alles ganz einfach, denn was wollen wir schon groß? Friede Freude Eierkuchen, doch was wird dafür für ein irrsinniger Aufwand getrieben!
Und trotzdem: Nicht ich bin irre, nicht all die anderen globalisierungsverwirrten Kleinstaatler im Geiste, nicht einmal die Zeiten sind über das übliche moderne Maß hinaus irre – und trotzdem ist unser Leben der blanke Irrsinn. Der aber zeigt sich nicht in unserem Verhalten, das sich doch nur an den Erfordernissen zum Überleben im modernen Alltag orientriert. Nein, worin sich der Irrsinn aber offenbart, ist die einzige absolut gesicherte Tatsache über das Wesen des modernen Menschen: Der ist nämlich eiskalt in der Lage, seine natürliche Umwelt, auf die er für sein physisches Überleben trotz aller Erleichterungstechnik und Konsumprodukten doch immer noch angewiesen ist, mit seinem überschüssigen Tatendrang und seiner Produktionswut zu schädigen, wenn nicht gar zu zerstören.
Die eigene Lebenswelt wohlgemerkt! Den Planeten A! Die Grundlage seines nackten Lebens! Und – oh Gipfel des Irrsinns – so manches Mal gar seine unmittelbare Umgebung! Aus diesem traurigen Umstand ergibt sich nun diese – versprochen! – allerletzte aller dummen Fragen. Ihre eminente Relevanz leuchtet in ihrer ganzen Einfachheit nach der Corona-Stubenhockerzeit vielleicht noch eher ein als zuvor, denn sie lautet: „Wo bin ich?“
Antwort: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zog ich wieder aus“ – doch doch, das ist die Antwort, denn keine rechte Antwort ist in diesem Falle die Antwort. Es sind nämlich die ersten beiden Zeilen aus dem Gedicht „Gute Nacht“ von Wilhelm Müller und damit aus Franz Schuberts Liederzyklus „Winterreise“ aus dem Jahr 1827. Sie spiegeln das Weltgefühl der Romantik, der ersten wahrhaft modernen bürgerlichen Massenbewegung in Deutschland, wider: Fremd kommt ein Mensch in die Welt, auf der er doch nur ein kurzzeitiger Gast bleibt und sie ebenso verloren wieder verlässt. Ein Unbehauster ohne festen Grund ist der moderne Mensch – und ist der rüde Umgang mit der Umwelt nicht das Ergebnis seiner geistigen Unbehaustheit? Zugegeben, ich, der Kleinstaatler im Geiste, hätte auf die Wo-Frage natürlich eher antworten sollen: „Heimat“. Aber die Wortwahl allein änderte nichts am geistigen Zustand des modernen Menschen, nur hieße der dann eben Heimatlosigkeit.
Heimatplanet B – Und trotzdem ist „Heimat“ der geeignete Begriff, mit dessen Hilfe wir uns selbst auf die Spur kommen können. Vergessen wir seinen Missbrauch, vergessen wir die Bedeutungseinengung auf Schützenvereine und Trachtengruppen, und vergessen wir die ziemlich nutzlose „Abteilung H“ im Bundesinnenministerium. „Heimat“ ist einfach ein zu kostbares Wort: Es schwingt sofort, es hat das Unbestimmte, dieses Fließende zwischen Dasein und Seele, das man braucht, wenn man den ganzen Menschen fassen will.
Und es verfügt die eine entscheidende Dimension mehr, als der nackte Humanismus legalistischer Sorte, für den jeder Mensch allen anderen gleichen soll – und natürlich auch sollte. Doch so schön dessen Utopie ist, so wird jener Humanismus immer nur im „Utopos“, dem „Nicht-Ort“, verbleiben, weil es eben immer auch ein „Wo“ im Leben des Menschen gibt: Ort und Zeit. Ich wandele durch Orte und Zeiten und gleichsam schleppe ich Ort und Zeit mit mir herum. Ich nehme Ort und Umgebung wahr und sie mich, ich werde von ihnen geprägt und ich präge sie.
Für das Ergebnis dieser Wechselwirkung gegenseitiger Prägung kann man schöne Worte finden: Kultur, Glauben, kollektive Erinnerung – und wer’s ganz modern mag, der sagt dann eben Gesellschaft. Aber es bleibt immer dasselbe: Heimat, der Ort und sein Geist, aus denen es kein Entrinnen gibt. Flucht ist unmöglich, weil sie sowohl im Hier und Jetzt verortet sind, als auch im Übersinnlichen. Und gerade jenen, die so modern sind, dass sie meinen, die überkommenen geistigen Fesseln aus der Geschichte, Religion oder Tradition könnten sie gar nicht mehr knebeln, denen kann der Begriff „Heimat“ als Schlüssel ins Übersinnliche dienen, eben weil mit diesem heimeligen Wort auch immer eine Vorstellung von einem konkreten Ort einhergeht.
Wer also das Wort Heimat auf diese Weise nutzbringend verwendet, der schafft es, dem Übersinnlichen Sinne zu verleihen. Denn im Grunde verbirgt sich hinter dem schönen Wort ein unbewusster Schrei, der aus der sonst allzu bereitwillig verdrängten kollektiven Überrealität ertönt. Er will uns gemahnen, dass die Produktionwut und ihre Logik beileibe nicht alles ist, womit wir unsere Welt zurecht zimmern. Die Übersinne sind viel mehr daran beteiligt – doch wie ist es bestellt um die kollektive Überrealität? Wie können wir sie erkennen? Oder besser: Wo?
Die heimatliche Fremde – Fremd sind wir eingezogen, fremd ziehen wir wieder aus… Zwischendrin versuche ich, es mir auf Erden so gemütlich wie möglich zu machen. Und ginge es nur um mich, um meine überschaubare Lebensspanne, es könnte es mir egal sein, was da vorher war und was noch kommen wird. Aber wie gesagt: Das ist es nicht. Denn da ist immer etwas, das schon war und uns in den Klauen hält, und etwas, was kommen wird und uns unweigerlich beschäftigt, allein, weil wir ahnen, dass wir in diesen beschleunigten Zeiten es auch noch erleben werden. Dem kollektiven Ganzen kann selbst ich, der Kleinstaatler im Geiste, mich nicht entziehen, wäre es nicht also besser, man wüsste, wie es darum bestellt ist?
Habe nun, ach, der Theorie genug studiert, doch jetzt wird es ernst und lustig zugleich, denn jetzt Sie sind dran! Ja Sie, liebe und so geduldige Leser: Machen Sie sich doch einmal den Spaß, einen tiefen Blick auf den Zustand unserer kollektiven Überrealität zu werfen. Denn nichts ist leichter als das! Es gibt nämlich ein überreales Anschauungsobjekt, das gleichsam so real ist, dass man ihm ebenso wenig wie der Überrealität entfliehen kann. Wo? In der Landschaft.
Lassen wir uns nun doch mal ein auf ein kleines Gedankenspiel, was uns vielleicht leichter fällt, nachdem uns Corona auf unsere Umgebung zurückgeworfen hatte. Betrachten wir also die Landschaft und unsere Umgebung als Abbild der kollektiven Seele, unserer Prägungen und unserer Kultur, aber eben auch dessen, was uns im Alltag umtreibt. In der Landschaft, im weiten Land wie in den engen Städten, verbleiben die Zeugnisse des Vergangenenen, während sich gleichzeitig unser heutiges Leben darin abspielt. Die Umgebung ist unser gemeinsames „Wo“ – und daran, wie man mit ihm umging und umgeht, zeigt sich unsere geistige Verfassung: Was war uns einstmals wichtig, was heute? Und was wünschen wir uns wirklich? Also nicht unbedingt das, was uns hehre humanistische Ideale in das flotte Mundwerk legen, sondern das, was wir – auch unbewusst und so manches Mal entgegen der eigenen großen Worte – tatsächlich wollen. Aber Achtung: Der Blick auf unsere wahren Wünsche kann so ernüchtern, wie der ein oder andere Blick in unsere modernen Landschaften.
So, damit wäre nun alles gesagt, auf geht’s mit offenen Augen durch die Lande. Auch die Warnung vor Enttäuschung übers Abbild der eigenen Seele ist vorsorglich mit auf den Weg gegeben. Nun liegt es an jedem selbst, hinzuschauen und das Geschaute so aufzunehmen, wie es ihm das eigene Gespür vermittelt. Vor uns liegt sie, die moderne Landschaft, ihre fragmentierten Zonen, die Übergänge und Grenzziehungen zwischen ihnen – und eben auch die Widersprüchlichkeit unserer eigenen Wünsche und Prioritäten.
Autobahnkleeblatt – Wie sieht das alles zusammen aus? Darauf sich einen Reim zu machen, fällt leichter, wenn man von draußen draufschaut. Martin Graff, der Radikal-Elsässer, hatte schon 1984 für den Charakter der deutschen Landschaften eine kurze Formel gefunden: „Immer diese Mischung aus Industrie und Romantik“. Und? Ist er etwa damit dem deutschen Charakter auf die Spur gekommen? Oder schon mal was von Industrieromantik gehört? Diese kalte Schönheit des Stahls, der Röhren und der endlosen Lichterketten entlang der Autobahnen – die deutsche Romantik pur. Gegenfrage an Frankreich: Auf welche Formeln ließen sich denn bitte schön diese ewig gleichen Shoppingzonen an den Einfahrten eines jeden französischen Städtchens bringen? Oder was offenbart uns die Tatsache, dass die aufmüpfigen Gelbwesten ihre Protestcamps ausgerechnet auf dem außerplanetarisch anmutetenden Landschaftselement des Verkehrskreisels eingerichtet hatten?
Wie gesagt: Schauen Sie am besten selbst, was Sie sehen und erkennen! Und es gibt so viel zu sehen in der Heimat, sogar vieles, was dort ist, aber eigentlich gar nicht mehr da ist – oder anders gesagt: Wo ich bin, war Heimat. Wie bitte: Ich bin, wo ich war? Vergangenheit in der Gegenwart? Hä? Doch doch! Die moderne fremde Heimat ist das bestehende Gewesene, denn alles was ist, könnte schon bald weg sein. Die andauernde Veränderung ist das Wesensmerkmal unserer Zeit und ihr heimatloser Geist vollzieht seine Umtriebigkeit zuletzt immer auch in der Landschaft. Und trotzdem ist es ein Leben inmitten eines Paradoxon: Zwar ändert sich alles in unserem Leben unentwegt, ohne aber, dass sich grundlegend etwas ändern würde. Diese Unstetigkeit ist der stete Dauerzustand – und damit auch der übermäßige Verbrauch des natürlichen Teils der Landschaft, der eigentlichen Quelle unseres Lebens und Überlebens. Wie viel Kraft es kosten würde, diese Umtriebigkeit einzuschränken und einfach auch einmal innezuhalten, hat uns die erzwungene Corona-Ruhe ja zumindest kurz andeuten können.
Swinging Landschaft – Ach, wenn man doch nur wüsste, wo sich jene geistige Heimat befände, die in ihrem Abbild dauerhaft Bestand hätte. Wie müsste eine kollektive Überrealität gestaltet sein, die in der realen Landschaft keine Schäden hinterließe? Ganz ehrlich: keine Ahnung. Aber immerhin kann uns der Begriff Heimat und seine von ihm ausgelösten Schwingung auf eine Spur bringen. Heimat ist immer nämlich das, was man nicht verändern zu müssen meint. Daraus wiederum lässt sich die grundsätzliche Erkenntnis ableiten, dass Umwelt- und Klimaschutz nicht unbedingt eine technische, sondern in erster Linie eine geistige Aufgabe ist – und schaut man in die Landschaft, vielleicht zuallererst eine ästhetische: Kann ja ruhig auch mal was Schönes einfach so bleiben dürfen, wie’s ist.
Aber lange Rede, kurzer Sinn: Schauen Sie in Ihre Umgebung und machen Sie sich Ihr eigenes Bild vom Kunstwerk der Landschaft und damit vom Zustand der kollektiven Übersinne. Mehr als die Selbsterkenntnis ist wohl derzeit nicht drin. Dazu ist der Zustand dieser Welt einfach zu irre. So konnte auch diese Abhandlung nur mehr Verwirrung als Klarheit stiften. Aber wenn die Rede von Heimat ist, verbleiben selbst Worte im unsagbaren Übersinnlichen – also genau dort, wo sie hingehören.
Noch ein letzter Versuch gefällig, alles Gesagte in eine schnittige Welterklärungsformel inklusive Handlungsanweisung zu fassen? Auf dass wir Kleinstaatler im Geiste während des Post-Corona-Globalisierungswiederherstellungswahnsinns weiß, worauf es nun ankäme. Lange Zeit galt als Formel zur Besserung der Welt der hehre Anspruch, man müsse immer schön global für alle mitdenken und dann entsprechend lokal handeln. Nach Corona sind wir schlauer und wir versuchen es einmal anders herum: Erst mal konsequent lokal denken, und wer weiß, vielleicht wird dadurch das Handeln dann automatisch global sein – doch dazu wäre es sehr hilfreich, statt einem letztlich doch nur abstrakten „Wir-Gefühl“ lieber ein ganz konkretes „Wo-Gefühl“ zu entwickeln: Hier bin ich, und da muss Heimat sein dürfen.
***
Puh, das war’s jetzt aber, Corona: Schluss, Aus, Ende, keine weiteren Fragen mehr – und ein herzliches Dankeschön an alle Leser, die meinen doch so manches Mal ziemlich abgehobenen Corona-Betrachtungen gefolgt waren. Alle Achtung! Sie werden jetzt natürlich zu recht fragen: Was hat es gebracht, sich mit Corona auf diese Weise zu befassen? Das globale Virus, heißt es meist, habe ja gar nichts Neues in der Welt heraufbeschworen, sondern bloß die zuvor nur unterschwellig wahrgenommenen Tendenzen in ihrer ganzen Tragik ans Licht gezerrt und die darin schwelenden Konflikte gar noch verschärft. Trotzdem soll nun erst einmal alles wieder so werden, wie es zuvor war. Wenn der Nachgang mit Corona, der als laue Testphase für die Bewältigung des Klimawandels gelten darf, eines zeigt, dann dieses: Wir werden uns immer nur im Kreise drehen, wenn man mit seinen Sinnen nicht bis in die Übersinne vordringt. Woran liegt’s, dass das nicht gelingen will? An den falschen Fragen! Also alles noch mal von vorn? Nein! Corona – es reicht…

Kommentar hinterlassen